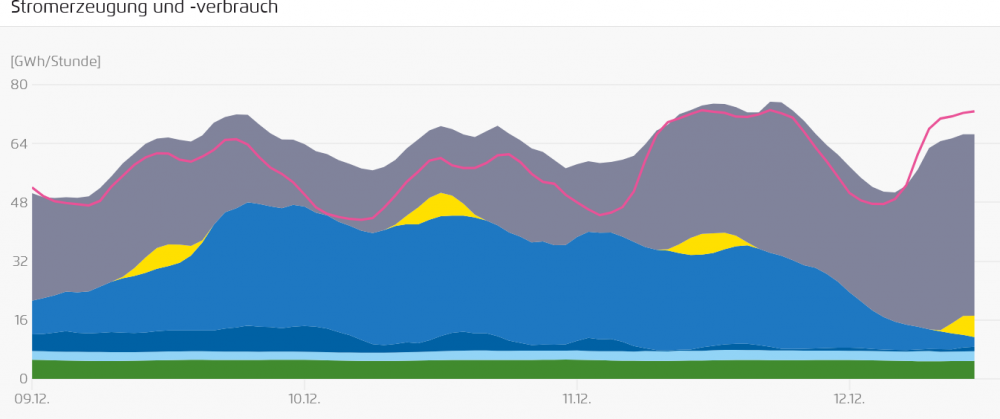Zitat geschrieben von wtt-betreiber
Uran liegt seit milliarden Jahren in der Erde
1
Gibts eigentlich auch einen solchen Fonds für den Rückbau der WKA und deren Fundamente?
2
3"werden die Transportrohre des Primärkühlkreislaufes nach einigen Jahren undicht" ... Belege dafür?
"Trotz einiger Vorteile von Flüssigsalzreaktoren wurden bis heute nur zwei kleinere Forschungsreaktoren gebaut" ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Flüssigsalzreaktor
Uran liegt NICHT angereichert im Boden.
 2
2 Rückbau der WKA, sind gesetzlich vorgeschrieben und die Kosten trägt der Betreiber.
 3
3Betriebliche und sicherheitstechnische Probleme
https://de.wikipedia.org/wiki/…e_Probleme
Da Spaltstoff und Spaltprodukte ständig aus dem aktiven Kern herausgeleitet werden, ist der effektive Anteil an verzögerten Neutronen niedrig, was die Regelbarkeit erheblich verschlechtert.
Die Ablagerung von Spaltprodukten, die in der Salzschmelze wenig löslich sind, auf den Oberflächen des Kreislaufs (plate out) erreicht ein erhebliches Ausmaß[53] und beeinträchtigt z. B. die Wartungsmöglichkeiten.
Eine moderne Sicherheitsbewertung (probabilistische Sicherheitsanalyse PRA/PSA) gibt es für Flüssigsalzreaktoren im Gegensatz zu den meisten anderen Reaktorkonzepten nicht.[54] Das Störfallspektrum des LFTR unterscheidet sich insgesamt ganz wesentlich von dem anderer Reaktortypen.[54] Selbst die Entwicklung von Methoden zur Sicherheitsanalyse von LFTR befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium.[55]
In graphitmoderierten LFTR kann es zu positiven Leistungsrückkopplungen mit entsprechendem Störfallpotential kommen.[49] Mit Untersuchungen zu LFTR-spezifischen Kritikalitätsstörfällen durch Auskristallisieren von Kernbrennstoff (loss of fuel solubility event) wurde erst begonnen.[56]
Die Tritiumproduktion in LFTR ist wegen des Lithiumgehalts mit 35 PBq/(GWela)[57] etwa 50-mal höher als in Druckwasserreaktoren oder in Schnellen Brütern. Wegen der verhältnismäßig hohen Temperaturen diffundiert Tritium zudem relativ leicht durch die Wandungen des Reaktorbehälters. Schon beim MSRE wurde die Tritiumrückhaltung dementsprechend als eines der größten Probleme angesehen.[53] Die unausgereifte Tritiumbehandlung war auch ein wesentliches Argument bei der Ablehnung des MSBR.[14]
Um dies zu umgehen, planen die Entwickler des Dual Fluid Reaktors, stattdessen eine UCl3-/PuCl3-Salzlösung zu verwenden, die wesentlich weniger Tritium entwickeln würde.
Entwicklungsstand
Bislang wurden noch keine Reaktoren in der jetzt konzipierten Leistungsgröße gebaut. Ebenso ist die nötige Wiederaufbereitung noch nicht im größeren Maßstab getestet. Gleiches gilt für den Einsatz von und das Brüten mit Thorium in Flüssigsalzreaktoren. Der insgesamt erforderliche Entwicklungsaufwand wird von britischen Nuklearexperten als so hoch eingeschätzt, dass noch 40 Jahre bis zur Serienreife eines MSR vergehen dürften.[58][59]
Proliferationsrisiken
Mit Thorium als Brennstoff entsteht im Prozessverlauf auch 233Uran. 233Uran hat eine ähnlich kleine kritische Masse wie 239Plutonium, aber eine viel kleinere Spontanspaltungsrate als Waffenplutonium, so dass es als optimales Kernwaffenmaterial gilt.[4] Aus Thorium reines 233U zu gewinnen, das für Kernwaffen gut nutzbar wäre, ist schwierig. Neben 233U entsteht nämlich auch gleichzeitig etwas 232U (unter anderem aus ebenfalls enthaltenem 230Th), und diese beiden Isotope sind fast unmöglich zu trennen. In der Zerfallsreihe von 232U entsteht harte Gammastrahlung. Diese erschwert die Handhabung und schränkt die Verwendung für Kernwaffen nach Meinung vieler Nuklearwissenschaftler erheblich ein.[60][61] Andere wissenschaftliche Analysen weisen jedoch auf ein deutliches Proliferationsrisiko durch 233Uran aus Thorium trotz Präsenz von 232U hin.[4] Auch wird argumentiert, dass mit 232U verunreinigtes 233U zwar für Kernwaffenstaaten unattraktiv ist, keineswegs aber für Staaten oder terroristische Gruppen, die sich illegal Zugang zu Kernwaffen verschaffen wollen, denn die Explosivkraft von 233U wird durch 232U kaum verringert.[62] Schließlich ist anzumerken, dass nicht 232U selbst die störende harte Gammastrahlung verursacht, sondern 208Tl, ein Nuklid in der Zerfallsreihe, welches erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung entsteht. Für die ersten Monate nach der 232U/233U-Abtrennung ist dessen Strahlung deshalb erheblich geringer, was seine Handhabung in dieser Phase erleichtert.[4] Weiterhin bestätigen neuere Untersuchungen die schon früher geäußerte Vermutung, dass speziell bei Thoriumverwendung ein erhebliches Missbrauchspotential besteht: Durch kontinuierliche Abtrennung von 233Pa (Halbwertszeit: 1 Monat) lässt sich im LFTR relativ reines, also 232U-armes, hochwaffenfähiges 233U gewinnen.[63][64] Entsprechendes wäre im U/Pu-Zyklus erheblich schwieriger. Diese Abtrennung von 233Pa ist – aus Gründen eines möglichst effizienten Betriebs – in vielen LFTR-Varianten sogar vorgesehen und wurde im Rahmen der MSBR-Entwicklung im Labormaßstab getestet. Solches 233U ließe sich schon in einer einfachen Kernwaffe im Gun-Design zur Explosion bringen und würde keine komplizierte Implosionstechnik wie im Fall von Plutonium erfordern.[4]
Zur Verringerung des Proliferationsrisikos beim MSR wurde schon in den 1970er Jahren Zumischung von 238U zum Flüssigsalz vorgeschlagen. Das ist aber bei 233Protactinium-Abtrennung fast unwirksam; es ist nur wirksam, wenn Uran, also 233U/238U aus dem Flüssigsalz isoliert wird, hat aber immer den Nachteil, dass die im Endlager problematischen Transurane aus 238U gebildet werden. Ein entsprechend besser gegen Proliferationsrisiken ausgelegter MSR wurde in den USA 1980 vorgestellt (DMSR): Neben 238U-Zugabe sieht dieses Konzept außer der Edelgasentfernung keine oder nur eine Online-Wiederaufarbeitung von geringer Kapazität vor. Allerdings kann der DMSR nicht als thermischer Brüter betrieben werden, sondern ist neben der Thorium- und 238U-Zufuhr auf ständige 235U-Spaltstoffzugabe angewiesen. Die Spaltstoffzufuhr bliebe jedoch deutlich geringer als in einem konventionellen LWR und die Uranvorräte ließen sich auf diese Weise um den Faktor 3 bis 5 strecken.[61]
Unabhängig vom Thorium stellt die Kombination von Reaktor und Wiederaufarbeitungsanlage, welche im LFTR angedacht ist, zwangsläufig ein großes Proliferationsrisiko dar.
Entsorgung
Das Problem der Behandlung und Entsorgung schwach bis mittelstark verstrahlter Maschinen- und Anlagenteile besteht in ähnlichem Maße wie bei herkömmlichen Uran-Reaktoren; die Menge ist auch hier abhängig von Aufbau und Lebensdauer der Anlage usw. Als zusätzliche Schwierigkeit bei der Entsorgung ist zu nennen, dass Spaltproduktfluoride nicht als endlagerfähig gelten, also erst in eine endlagerfähige Form aufgearbeitet werden müssen.[53]
Kritische Expertenstudien zu MSR und Thoriumnutzung
Einen Überblick auch zu Nachteilen und Herausforderungen gibt die Literatur von Mathieu und anderen Autoren.[49]
Die staatlichen britischen National Nuclear Laboratories (NNL) haben seit 2010 im Auftrag der Britischen Regierung mehrere Bewertungen zu Thorium und LFTR abgegeben. Hauptkritikpunkte sind der unausgereifte Charakter dieser Technologien, die weitgehend fehlenden Nachweise für die behaupteten Vorteile und günstigen Eigenschaften, die fehlende Bereitschaft der Nuklearindustrie, diese erforderlichen kostenintensiven Nachweise beizubringen, sowie Zweifel an ökonomischen Vorteilen. NNL hält viele Ansprüche der Thorium/LFTR-Befürworter für weit überzogen und warnt daher vor Euphorie.[65][58][59]
Bereits 2008 hatte ein unter Beteiligung internationaler Experten erstelltes Gutachten für die norwegische Regierung vor großen Hoffnungen bezüglich der Thoriumverwendung gewarnt.[62][66][67]
Der Whistleblower Rainer Moormann veröffentlichte 2018 eine kritische Stellungnahme zur Thoriumnutzung und wies vor allem auf erhöhte Proliferationsrisiken durch den auch für Terroristen leicht möglichen Bau einer Atombombe aus 233U hin.[68][69]
 . https://www.spiegel.de/wirtsch…ef64a71bb9.
. https://www.spiegel.de/wirtsch…ef64a71bb9.
 . https://www.spiegel.de/wirtsch…ef64a71bb9.
. https://www.spiegel.de/wirtsch…ef64a71bb9.